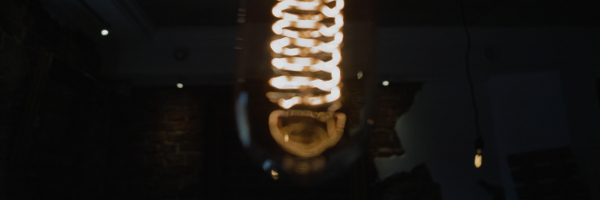Der Weg nach Barth führt über Velgast. Früher ging man in Velgast unter Aufsicht des Schaffners über die Gleise, wenn man umsteigen musste. Jetzt gibt es in Velgast keinen Schaffner mehr, aber eine Notrufsäule und einen tiefen, feuchten Tunnel, durch den wir die Fahrräder tragen. Auf der anderen Seite wartet der Triebwagen nach Barth. Hier fing die Darßbahn an.
Der Fahrradweg von Barth bis Bresewitz geht an der alten Bahntrasse entlang. Die Meiningenbrücke liegt im Dornröschenschlaf.

Wir fahren nicht über Zingst, sondern biegen vor dem Freesenbruch westlich ab und nehmen die alte, holprige Plattenstraße über die trockengelegten Wiesen. Hier war ich noch nie. Auf dem Prerowstrom kriecht ein als Raddampfer verkleidetes Ausflugsschiff an uns vorbei. Vor uns fliegt ein Graureiher.

Kurz zum Strand hinunter, der Ostsee Guten Tag sagen. Die Sturmflut hat die halbe Düne mitgenommen.
An Prerow fahren wir nur vorbei, weiter nach Wieck. Über der Wiese ein Rotmilan. Der Fahrradweg ist auf einmal vollkommen leer. Im Haus von Oma Wieck sind jetzt Ferienwohnungen, wie überall. Wir gehen auf den Hof, die Scheune und die Baracke sind auch längst fort, alles ist überbaut. Eine Frau kommt auf uns zu und erkennt mich. Auf dem Dorf wissen alle, wer du bist. Am Haus meiner Eltern vorbei. Das Saunahäuschen steht noch da und auch die Hecke haben meine Eltern gepflanzt. Aber der Carport ist vergrößert worden, natürlich. Der Sandweg zum Friedhof im Wald wurde asphaltiert. Auf dem Parkplatz darf man maximal drei Stunden stehen, mit Parkuhr. Drei Stunden müssen reichen für’s Traurigsein, stimmt schon.

In den ewigen Darßwald, bis Peters Kreuz. Dort biegen wir nach Süden ab und fahren nach Born. Am Hafen sitzen wir im kühlen Bauch des Walfischhauses, draußen ist Sommer. Wir warten auf die MS Heidi, die uns zurück aufs Festland bringt. Auf dem Koppelstrom Schwäne. Auf einer Wiese am Waldrand sehen wir Hirsche, einer geht zum Ufer, um zu baden. In Bodstedt steigen wir aus, für die letzten Kilometer der Rundreise ist der Ostwind gegen uns.

In Barth haben wir eine Stunde Zeit, bis der Zug fährt. Wir fahren noch einmal die alten Wege. Am Haus der Werktätigen vorbei, über den Friedhofswall zu unserem alten Garten, der kaum noch zu erkennen ist, vielleicht die alte Tür in der Laube und das Pflaster auf dem Weg. Rechts hinter dem Rathaus der Sportplatz, auf der alten Aschenbahn liegt jetzt Tartan, aber die Pappeln stehen noch. Den Teergang entlang, der in Wirklichkeit aus Betonplatten besteht, zu unserem Haus in der Schillerstraße 10, zum Spielplatz mit der Wippe, meinen alten Schulweg, über den Wall schließlich zurück zum Bahnhof. Die Bäume sind gewachsen und die Straßen sind kleiner geworden. Ein Tourist sein und zugleich zu Hause.